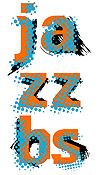Chalaba
Das Joachim Kühn-Trio interpretiert die Tradition neu
„Es freut mich wirklich sehr, hier in Braunschweig zu sein! Braunschweig forever!“ Wer kennt sie nicht, diese Redewendungen von Künstlern. Captatio benevolentiae, ein altes Stilmittel der klassischen Rhetorik. Die Leute für sich gewinnen, bevor es zur Sache geht.
In unserem Falle aber steckt mehr dahinter. Joachim Kühn, unbestritten der große deutsche Jazzpianist, geizte nicht mit Komplimenten in Bezug auf Braunschweig am Sonntagabend anlässlich seines Auftritts im LOT-Theater. Nicht nur viermal gastierte er in Braunschweig, wie offiziell verkündet, nein, mindestens fünfmal, und ich wage zu behaupten, dass es sechsmal war. Schon 1972 spielte er im Lindenhof, jammte zusammen mit dem Braunschweiger Piano-Urgestein Otto Wolters. Aber er hat vorher, oder zeitgleich, auch im Audimax der TU BS Solopiano gespielt. Sehr, sehr frei, was viele als willkürlich und dilettantisch empfanden. Egal, er spielte seitdem regelmäßig in Braunschweig, dank der guten Betreuung durch die Musikerinitiative BS und wegen des aufmerksamen Publikums. Großartig das Trio mit J.F. Jenny- Clarke und Daniel Humair. Nur in Paris sei er noch häufiger aufgetreten.
Nun ist er 70 Jahre alt geworden und wieder in Braunschweig und praktizierte, was von der Idee her nicht ganz neu ist, aber eine typisch Kühn’sche Lösung erfuhr: die Aneignung, Konfrontation von amerikanisch-europäischer Jazztradition mit den Skalen und Rhythmen der Musik seines marokkanischen Freundes Majid Bekkas, am Schlagzeug und Perkussion hervorragend und unnachahmlich unterstützt durch den Spanier Ramon Lopez.
Kühn nennt diese Musik „Weltmusik“, andere Ethno-Jazz, was vielleicht besser ist, damit er nicht plötzlich als Peter Gabriel des Jazz eingeordnet wird. Und dass es sich bei seiner Musik nicht um schmusige Folklorisierung des Jazz handelt, das machte das Trio von Beginn an klar.
Kühn wirbelte Hörerwartungen beim Intro „Live Experience“ durcheinander. Unheimliches Tempo, das die nächsten Stücke nicht abflauen sollte, und die Verweigerung eines geordneten Zusammenspiels. Freies Warming up? Nein. Wie aus dem Nichts heraus, ein Riff, das von allen aufgegriffen und variiert wird. Klar strukturierte Dialoge zwischen Kühn und Bekkas Guembi, einer dreisaitigen bassähnlichen Laute, kraftvoll durchbrochen vom Schlagzeug. Eine Wanderung zwischen Ordnung und Chaos, dominiert von rhythmischen Akzenten. Es ist die Gnawa-Musik, die Majid Bekkas in das Trio einbringt. Die Musik einer ethnischen Minderheit in Marokko, aus der Süd-Sahara, aus Mali, der Wiege des Blues. Bekkas Gesang zitiert die Roots der Fieldhollers der Sklaven im Süden der USA. Das Spiel mit der Guembi ist archaisch-rhythmisch, auf den Punkt gebracht im Stück „Chalaba“. Magisch repetitiv ist das Riff, ist der Gesang. Man versteht nicht die Worte, man hört nur den Klang der Stimme und erahnt Anruf, Response, Klage, Ekstase. Afrikanische Kosmogonie, die in der Repetition den Weg in die emotionale Tiefe und in eine höhere Ordnung eröffnet. Anders als später im afroamerikanischen Blues, der sich eine strikte Ordnung verschrieb. Diesen Hintergrund eröffnet Bekkas.
Kühn unterstützt das expressiv am Altsaxofon, am Klavier aber setzt er seine musikalische Welt dagegen bzw. er schafft Lücken für andere Sichtweisen auf die Tradition. Das geschieht wiederum nicht als Kollision, indem etwa europäisches Harmonieverständnis dagegen gesetzt wird. Kühn spielt eine gewissermaßen offene Stimmung. Die Akkorde bleiben uneindeutig, sie sind vermindert oder erweitert, sie orientieren sich nicht an der harmonischen Systematik, sondern am Klangcharakter, der gerade besteht.
Kühn ist ein Altmeister, das Tempo, das er im ersten Set anschlug, sollte wohl demonstrieren, dass er nicht zu den Altersmilden gerechnet werden will, die auf den musikalischen Anspruch verzichten. Im zweiten Set war das Zusammenspiel ruhiger ohne an Dynamik zu verlieren. Nur, wenn Kühn in seine Tonwirbel hineingerät, dann gibt es einfach kein Halten für ihn. Es spielt ihn, könnte man meinen.
Das Konzert war nahezu ausverkauft, trotz Eugen Cicero, trotz Tatort und trotz Sonntagabend überhaupt. Und die Begeisterung war groß. Eine Bemerkung aber zum Abschluss. Die „Hardcore-Jazzer“ hatten Vorbehalte, was den nordafrikanischen Gesang betraf. Ja, es sind andere als die europäisch geprägten Skalen, teilweise ein ganz anderes musikalisches Verständnis. Aber – warum ist man verzückt vom Gilberto-Gesang beim „Girl in Ipanema“? Soll das jazz-affiner sein als der Gnawa-Gesang? Auch Geschmacksurteile sind zu überprüfen.
Klaus Gohlke
Erschienen in kulturblog38.net am 2. 10. 2014