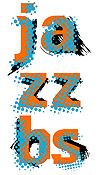Die stille Show
Jazzkonzerte bieten dem Auge des geneigten Hörers besondere Erlebnisse
Musik ist zuallererst ein physikalisches Ereignis. Es geht um Schwingungen der Luftsäule, um physikalisch-akustische Gesetzmäßigkeiten. So weit, so einfach. Was diese Schwingungen dann hervorrufen, kann man knochentrocken und sehr zutreffend mit dem Musikhistoriker Alex Ross „eigenartige Empfindungen“ nennen. Jeder Konzertbesuch illustriert das. Gleichzeitig aber wird auch das Auge bei Konzerten angesprochen. Es soll hier nicht um die Shows populärer Musik gehen, etwa die Akrobatik-Einlagen von Helene Fischer oder die Multimedia-Shows eines Udo Lindenberg. Es geht hier nicht um zielgerichtete Handlungen, vielmehr um etwas Beiläufiges und Stilles: um Mimik und Gesten vor allem. Etwas, das besonders bei Jazzkonzerten eine zusätzliche Ebene der Beobachtung, eine zusätzliche Intimität bietet, die es anderswo in der Musik in dieser unmittelbaren Form nicht gibt.
Was erlebte man nun beim Konzert des Arild-Andersen-Trios am Samstagabend im Braunschweiger LOT-Theater so ganz beiläufig? Um es ganz klar zu sagen: nichts Sensationelles. Etwas, was sich in jedem Jazzkonzert ereignet, allerdings kaum Beachtung findet, obwohl es doch individuell immer wieder anders ausgeprägt ist.
Also: Andersen spricht seine Musik, zumindest bewegen sich seine Lippen während des Spielens permanent. Es könnte auch ein inneres Singen sein. Jedenfalls eher still. Nicht wie bei Keith Jarrett dieses hochtönige Untermalen.
Der schottische Saxofonist Tommy Smith fällt auf andere Weise auf. Nicht beim Musizieren, wohl aber beim Zuhören. Er geht in die Hocke, fixiert seinen Bandleader aufmerksam und zeigt sich bei einigen Bassläufen höchst interessiert. Gleichzeitig verfolgt seine rechte Hand oft den rhythmischen Verlauf des Spiels seiner Kollegen. Er kann nicht loslassen, wenn man so will. Thomas Strønen, der Schlagzeuger, wird auf seltsame Weise von der Rhythmusarbeit angepackt. Je nach dynamischem Einsatz streckt sich der ganze Körper nach oben, dreht sich nach links bzw. rechts, begleitet mitunter von einem milden Lächeln. Nach Phasen höchster Konzentration, im Spannungsabfall, wirkt er wie im Trance-Zustand mit glasig-verschleiertem Blick.
Interessant sind die Momente, und derer gibt es an diesem Abend recht viele, in denen die Musiker lächeln: einzeln, zu zweit oder auch kollektiv. Was mag das Belustigende, Erfreuliche sein? Man kann oft nur rätseln. Eine unerwartete Variante im Spiel? Ein kleiner Fehler, nur dem Insider bemerkbar? Ein besonderer musikalischer Coup? Oder ziehen die Burschen nur die Shownummer „cooler Jazzer“ ab? Mitunter aber ist der Grund erkennbar. Wenn Andersen etwa mitten im Stück den Rhythmus über drei, vier Takte jäh verändert. Einfach so ein kleiner musikalischer Scherz. Variatio delectat. Das lässt schon mal grinsen.
Dass das Spiel an die psycho-physische Substanz geht, ist nicht zu verbergen. Es muss nicht unbedingt so ein speediger Fetzer sein wie „Outhouse“, der nach Luft schnappen lässt. Auch langsame Balladen, Uni-Sono- und Soloparts fordern Etliches ab, was zu einem Aufrichten, Lockern, Zurücktreten zwingt. Vor allem zu einem ständigen Blickkontakt während des Spiels. Man nennt das „das Interplay“, das Zusammenwirken der Musiker, hier auf der visuellen Ebene. Man mag noch so lange miteinander gespielt und Automatismen eingeschliffen haben. Der Zeitpunkt der Changes, die Dauer der Soli, die emotionale Verfassung der Einzelnen kann nur über den Blick erfasst werden. Interplay als Spiel der Blicke zwischen den Protagonisten.
Die drei Herren sind allesamt gestandene Musiker, aber – und das sollte das Publikum in seinem Selbstwertgefühl doch erheblich stärken – wenn es den Zwischenbeifall für gelungene Solo-Arbeit gibt, dann freuen sie sich aufrichtig. Tommy schottisch knapp, Thomas noch etwas erschöpft, am gelöstesten aber Arild, trotz seiner fast 50jährigen Karriere. Und diese Freude über ein gelungenes Konzert und die Ovationen des Publikums erscheint wieder völlig ungekünstelt am Konzertende und wird mit Zugaben belohnt.
Und was sieht der Musiker, wenn er ins Publikum blickt? Das sei ein anderes Thema.
(Ein Beitrag zu Peter Rüedis „Ästhetik des Beiläufigen“)
Klaus Gohlke